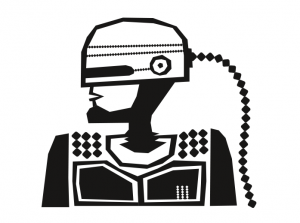RFID ist die Abkürzung für radio frequency identification, «Funkfrequenzerkennung». RFID besteht aus einem Lesegerät mit einem Sender und einem sogenannten Transponder, der ein Funksignal empfangen und automatisch beantworten kann. Dieser Transponder ist passiv: Er benötigt keine Stromversorgung, denn die Energie, die er zum Funken braucht, bezieht er aus dem elektromagnetischen Feld des Senders. Daher kann er geradezu winzig sein: In Fingernagelgrösse sitzt er auf Kreditkarten, klein wie ein Reiskorn lässt er sich implantieren, und flach wie eine Briefmarke wird er auf Produkte geklebt. Türschliessanlage, Wareninventar, Hundesteuer, Buchausleihe, Passkontrolle: Nichts, was sich mit RFID nicht eindeutig identifizieren liesse. Der Vater von RFID waren der Elektroingenieur Charles Walton und seine Firma im Silicon Valley. Walton war nicht der erste, aber wohl der geschäftstüchtigste Forscher auf diesem Gebiet, und 1983 wurde sein Funkprinzip patentiert.
RFID hat die Welt erobert. Kontaktlos zahlen wir heute im Supermarkt, an der Tankstelle, im Café. Wir halten unsere Bank– oder Kreditkarte, das Handy oder gar die Armbanduhr an den Leser – und die Rechnung ist beglichen. Weil das Funksignal verschlüsselt ist, weil der integrierte Transponder nur auf eine Entfernung von wenigen Zentimetern funktioniert und sich aus der Ferne nicht hacken lässt, gilt RFID als sehr sicher; bei kleineren Beträgen ist in der Regel nicht einmal mehr ein PIN notwendig.
Die RFID-Patente sind längst abgelaufen, und Erfinder Walton starb 2011. Seine Erfindung aber ist lebendig wie nie.