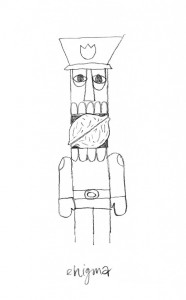Wir schreiben das Jahr 1967. Der Ingenieur Lawrence Roberts, Architekt des Arpanet und damit einer der Väter des modernen Internet, war felsenfest überzeugt: Das Austauschen von Textmitteilungen unter den Netzwerkteilnehmern, so schrieb er, sei «kein wichtiger Beweggrund, ein Netz von wissenschaftlichen Rechnern aufzubauen». Es war die Zeit, als Telex noch ein schnelles Kommunikationsmittel war, als Computer noch schrankgross und nur etwas für die crème de la crème der Wissenschaft waren. «Not an important motivation» – welch krasse Fehleinschätzung!
Heute tragen wir Computer in der Tasche, die ein Eintausendfaches jener Rechner leisten, mit denen Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins 1969 auf den Mond gesteuert wurden, Computer, die gleich auch noch telefonieren können und lichtschnelle Postboten sind.
Die Post, damals Briefe oder Lochstreifen, ist heute digital. Und auch sie hat sich vervielfacht. 107 Billionen E-Mails wurden allein letztes Jahr verschickt, eine Zahl mit zwölf Nullen. Druckte man die alle auf Papier, der Turm reichte von der Erde bis hoch zur Venus.
Nur das Recht ist noch nicht so ganz im Internetzeitalter angekommen: E-Mails sind bis heute keine echten Beweismittel. Wer klagen will und nur eine E-Mail in der Hand hat, wird’s vor dem Richter schwer haben. Anders ist das beim Telefax, einer Technik, die fast schon ins Museum gehört.
Bei dieser ozeanischen Flut von E-Mails müsste man meinen, die Menschheit habe noch nie so viel geschrieben und gelesen wie heute. Schön wär’s. Neun von zehn aller Mails dieser Welt sind Spam.