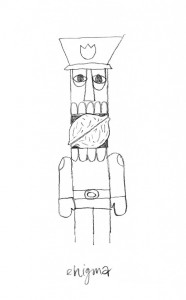«Beginnen darf, wer eine 5 gewürfelt hat. Kommt ein Stein auf ein Feld, das von einem feindlichen Stein besetzt ist, so wird dieser geschlagen und muss noch einmal von vorne anfangen.» So steht es in der Anleitung zu «Eile mit Weile». «Eile mit Weile» ist ein Spiel mit einer langen Geschichte. «Dieses ausserordentlich interessante Spiel hat sich in kurzer Zeit so viele Freunde erworben, dass es als wirklich gediegene Unterhaltungsgabe jedermann aufs beste empfohlen werden kann», lobt eine Spielanleitung schon ums Jahr 1900.
Doch «Eile mit Weile» ist viel älter: Es stammt vom altindischen «Pachisi» ab, einem Spiel, das schon im 6. Jh. gespielt wurde. «Pachisi» ist komplexer, weil es stärker auf Strategie und Taktik fokussiert. Die vier Spieler bilden zwei gegnerische Teams, und gespielt wird nicht mit Würfeln, sondern mit fünf, sechs oder sieben Kaurischnecken, bei denen die oben liegenden Öffnungen gezählt werden. Weil in «Pachisi» die Spieler in der Mitte beginnen, das Brett im Gegenuhrzeigersinn umrunden und am Ende wieder im Zentrum ankommen, vermuten Spieleforscher fernöstliche Symbolik: Menschen werden geboren und ziehen in die Welt hinaus, erleiden Schicksalsschläge, werden wiedergeboren – und gelangen am Ende ins Paradies.
Auch «Pachisi» zog in die Welt hinaus und kam im 17. Jh. nach Grossbritannien. Mit etwas einfacheren Regeln wurde das Spiel nach 1900 in der Deutschweiz zu «Eile mit Weile», in der Romandie zu «Hâte-toi lentement», in Norditalien zu «Chi va piano va sano» oder in Deutschland zu «Mensch ärgere dich nicht» – und eroberte so die Familientische Europas.