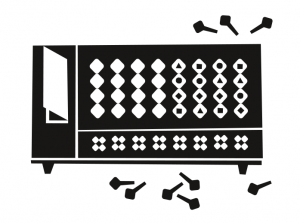1843 erschien in London ein Büchlein mit dem Titel «A Book of Nonsense», und dieses Büchlein hatte es in sich. Es enthielt 107 Nonsens-Gedichte des britischen Schriftstellers und Malers Edward Lear, von ihm selbst illustriert, die alle einem verblüffend eingängigen Schema folgten. Zwei lange Zeilen, die sich reimen. Dann zwei kurze, die sich ebenfalls reimen, am Ende ein fünfter langer Vers mit dem Anfangsreim. Immer nahm Lear eine fiktive Person auf die Schippe, die an einem realen Ort lebt, und die sich durch eine geradezu absurde Angewohnheit oder Eigenschaft auszeichnet.
Weil diese Strophenform einem alten irischen Soldatenlied gleicht, «Will You Come up to Limerick», wurde der Scherzvers bald einmal «Limerick» genannt. Auch wenn Dichter Lear nicht der Erfinder war – schon bei Shakespeare finden sich ähnlich gebaute Verse –, traf der Limerick einen Nerv. Mit einer Pointe, in die Schlusszeile verpackt, zählt er heute zum festen Repertoire von Humoristen in aller Welt. In der Version des Schweizer Kabarettisten César Keiser klang das 1964 zum Beispiel so:
Da gab’s einen Forscher in Brahmen
Der bastelte künstliche Damen,
Wobei ihm die vierte
Zum Teil explodierte,
Jetzt bastelt er keine mehr. Amen.
Wer jetzt vom Ehrgeiz gepackt ist und sich fragt, wie genau man einen Limerick zu schreiben hat, dem sei auch das erklärt. Am besten in einem Limerick:
Ein Limerick-Dichter aus Leimen
War stolz auf sein treffliches Reimen.
Doch macht’s nicht allein
Der treffliche Reim:
Man muss auch den Rhythmus gut timen.