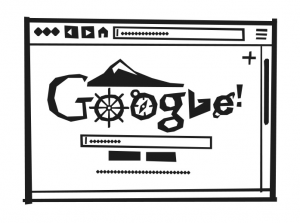Wenn wir am Morgen verschlafen zur Brille greifen, dann verschwenden wir keinen Gedanken daran, welche Bedeutung ihre Erfindung gehabt haben muss. Das ist ja auch schon eine Weile her: Das erste Gemälde, auf dem eine Brille zu sehen ist (auf der Nase eines Kirchenfürsten in Frankreich), stammt aus dem Jahr 1352. Doch Augengläser gab es schon lange vorher: Dass eine Linse das Licht auf ganz besondere Weise bricht, war schon in der Antike bekannt; angeblich soll bereits im 3. Jh. v. Chr. der griechische Gelehrte Archimedes einen Kristall zur Sehkorrektur benutzt haben. Nachahmer fand er noch keine – zwar soll Kaiser Nero im 1. Jh. n. Chr. Gladiatorenkämpfe durch Gläser aus grünem Smaragd verfolgt haben, doch die dienten nicht zur Sehkorrektur, sondern nur zum Schutz der Augen vor dem gleissenden Sonnenlicht. Bekannt waren dagegen Linsen, die das Licht bündelten, um Feuer zu entfachen. Neros Berater Seneca wiederum wusste, dass sich kleine Buchstaben mithilfe einer wassergefüllten Glaskugel vergrössern liessen. Die Wikinger schliesslich entdeckten, dass das Ergebnis noch besser war, wenn man geschliffene Kristalle auf Buchseiten legte – auf diese Weise wurde die Schrift auch für Weitsichtige lesbar.
Das Schleifen von Linsen setzte Glas oder durchsichtige Halbedelsteine voraus – Bergkristall oder auch das häufig vorkommende Silikatmineral Beryll. Aus Beryll wurden im Mittelalter die Sichtfenster von Reliquiaren und Monstranzen geschliffen, Linsen, durch die man die eingeschlossenen Reliquien sehen konnte. Und so wurde der Kristall namens Beryll zum Inbegriff alles Durchsichtigen – und am Ende zu unserem heutigen Wort «Brille».