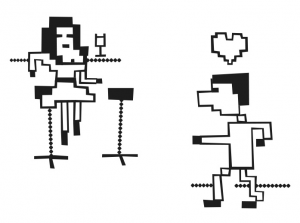Als der dänische Physiker Per Bak Kindern beim Spielen am Strand zusah, wurde er auf einmal stutzig. Die Kinder liessen Sand aus der Hand rieseln, so dass ein Häufchen entstand. «Am Anfang ist dieses flach», schrieb Bak später in seinem Buch «How Nature Works» von 1996, «und die einzelnen Sandkörner bleiben mehr oder weniger liegen, wo sie gelandet sind. Die Bewegung des Sandes lässt sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften beschreiben. Mit der Zeit aber werden die Hänge steiler, und es bilden sich kleine Lawinen. Und irgendwann wird eine Lawine so gewaltig sein, dass sie den Haufen als Ganzes erfasst.»
Bak beschloss, solche Sandhaufen am Computer zu simulieren, um so die durchschnittliche Grösse einer Lawine herauszufinden. Die ernüchternde Antwort, nach der Berechnung zahlloser virtueller Sandhaufen: Es gibt keine durchschnittliche Lawine. Die Eigenschaften von Systemen, die einen kritischen Punkt erreicht haben – ganz von selbst, ohne Zutun von aussen –, können sich urplötzlich dramatisch ändern. Wie gross dann eine nächste Lawine sein wird, lässt sich nicht mehr vorhersagen.
Diese Unberechenbarkeit nannte Bak «selbstorganisierte Kritikalität». Und die betrifft beileibe nicht nur Sandhaufen: Lawinen, Waldbrände, Erdbeben sind ebenfalls Systeme, die ganz von selbst kippen können. Das gilt schliesslich auch für die Wirtschaft und die Märkte: Der durchschnittliche Umfang eines Börsencrashs lässt sich mit Modellen nicht vorhersagen, und so kann eine Pleite, ein Konflikt, eine Epidemie das eine letzte Sandkorn sein, das den ganzen Haufen zum Einsturz bringt.