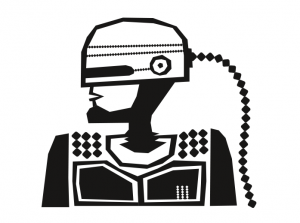So klingt der wohl berühmteste Countdown aller Zeiten: Am 16. Juli 1969 um 9.32 Uhr Ortszeit startet eine Saturn-V-Rakete in Cape Canaveral, Florida. An Bord: Die Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin.
Mit dem Countdown, auf Deutsch «Zurückzählen», werden grosse Ereignisse eingeleitet. Seine Abkürzung ist das grosse T als Abkürzung für «Test»; «T minus 10» heisst also noch zehn Minuten bis zum Start. Der Countdown verläuft in der Regel still, nur die letzten Sekunden werden laut gezählt. Sein Sinn liegt in der Verknüpfung einer Vielzahl von Kontrollen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in engen, sekundengenau festgelegten Zeitfenstern vorgenommen werden müssen. Ein einziger Fehler führt zum sofortigen Anhalten, wenn nicht sogar zum Abbruch des Starts.
Doch eigentlich kommt der Countdown nicht aus der Raumfahrt, sondern aus dem Film. Als der Regisseur Fritz Lang 1929 den Stummfilm «Frau im Mond» drehte, hatte er ein dramaturgisches Problem:
Wenn ich eins, zwei, drei, vier, zehn, fünfzig, hundert zähle,
sagte er später,
weiss das Publikum nicht, wann es losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null! – dann verstehen sie.
Der Countdown als Spezialeffekt der ersten Stunde: Was 1929 im Kino Spannung erzeugte, perfektionierte die Nasa 40 Jahre später zum medialen Weltereignis: 600 Millionen Menschen zählten am Fernsehen mit – vom Countdown bis zu den ersten Schritten auf dem Mond.