Als google.com am 7. September 1998 als Testversion ans Netz ging, war sie noch das Privatprojekt der beiden 25-jährigen Informatiker Larry Page und Sergey Brin in ihrer Garage im kalifornischen Menlo Park, die als erster Firmensitz herhalten musste. Search the web using Google, stand fast bittend auf der schlichten Seite mit den bunten Google-Buchstaben, denn andere hatten das Geschäft längst unter sich aufgeteilt: Altavista und Yahoo hiessen die Giganten, und ein weiteres Dutzend Suchmaschinen buhlten um die Gunst der User.
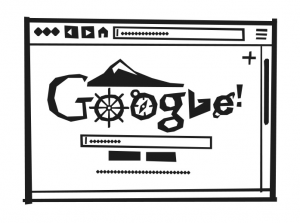
Und weil Google nicht nur sucht, sondern auch kostet, ersannen Page und Brin Kleininserate, die so genannten Google ads, die exakt in den Zusammenhang passen, wo sie platziert werden, weil Google eben in der Lage ist, Relevanz zu berechnen und in Sekundenbruchteilen auszuwerten. Mit diesen Anzeigen verdiente Google 2008 21 Milliarden Dollar.
Google eine Suchmaschine zu nennen, ist so stark untertrieben, dass es schon fast gelogen ist: Google ist Weltkarte, E-Mail, Fotodienst, Nachrichtenagentur, Bibliothek und Softwareschmiede. Mit Google lässt sich rechnen, planen, chatten und sogar videotelefonieren. Google ist ein Weltkonzern geworden – und sein Name ist Programm: Ein Googol ist der mathematische Begriff für eine gigantische Zahl: eine 1 mit einhundert Nullen.

