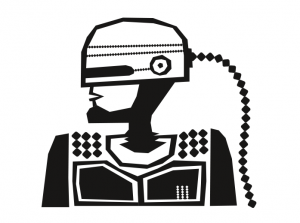Ein Cyanometer ist ein einfacher Ring aus Karton. Seine Segmente zeigen, von hell bis dunkel, alle möglichen Blautöne an. Hält man das Cyanometer gegen den Himmel, findet man stets ein Blau, das zur aktuellen Himmelsfarbe passt.
Erfunden hat das Cyanometer der Genfer Naturforscher Horace Bénédict de Saussure in den 1760er-Jahren. De Saussure erkannte, dass der Blauwert auf den Wassergehalt der Luft schliessen lässt: Je blauer der Himmel, desto weniger Dampf, je weisser, desto mehr. De Saussure trug die Blautöne mit Wasserfarbe auf insgesamt 53 Papierstreifen auf, die er auf einen Pappring klebte, von weiss, das de Saussure mit «0» bezeichnete, über alle Blautöne hinweg bis hin zu schwarz , das den Wert «52» trug.
Solche Cyanometer pflegte de Saussure an befreundete Wissenschaftler abzugeben mit dem Ziel, das Himmelsblau an möglichst vielen verschiedenen Orten zu ermitteln. Tatsächlich trug der junge Alexander von Humboldt 1802 ein solches Cyanometer bei sich, als er in Ecuador den 6263 Meter hohen Chimborazo bestieg, der damals als höchster Berg der Erde galt. Der Aufstieg war beschwerlich, und die Alpinisten kämpften mit der Höhenkrankheit. Erst auf dem Gipfel klarte das Wetter auf und gab den Blick frei auf das dunkelste Blau, das bis dahin je gemessen wurde: 46 Grad auf dem Cyanometer.
Das Blau des Himmels messen kann heute jedermann: De Saussures Cyanometer gibt’s, ganz einfach, als App.