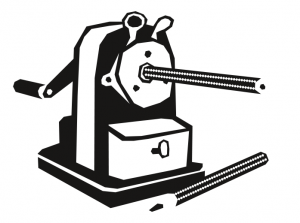Eigentlich war es ja einfach ein erster Arbeitstag, wie wir ihn alle schon erlebt haben. Nur dass wir nicht Barack Obama heissen und nicht den Job des US-Präsidenten bekommen haben.
Und darum schrieb die Weltpresse auch nicht über uns und unser Handy, sondern über Barack Obama und sein geliebtes Blackberry. Oder besser: über sein früheres Blackberry. Für nicht Eingeweihte: Blackberry ist der Hersteller von Handys der Spitzenklasse – mit E-Mail, Internet und vielem mehr.
Doch Barack Obama musste sich von seinem Blackberry verabschieden. Der Entzug wird Obama schwer getroffen haben – die amerikanischen Medien hatten schon lange über eine veritable Blackberry-Sucht des neuen Präsidenten spekuliert – aber er musste sein.
Da ist einmal die Sicherheit: Wenn es Hacker bereits schaffen, in die Computer der Nasa, der US Air Force, ja selbst des Weissen Hauses einzudringen, dann ist ein Blackberry einfach nicht sicher genug. Aber da ist noch ein anderer Grund: ein Gesetz aus dem Jahr 1978, der Presidential Records Act. Dieses Gesetz schreibt vor, dass jedes Fitzelchen Korrespondenz eines amerikanischen Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben werden muss. Mit dem Handy an Archivaren vorbeigeschmuggelte E-Mails, und seien sie noch so privat, sind Obama also sogar per Gesetz verboten.
Schon seinem Vorgänger, George W. Bush, kam der Presidential Records Act in die Quere. Vor seinem Amtsantritt soll sich Bush von seinen Mailfreunden verabschiedet haben mit den Worten: «Das macht mich traurig. Ich habe mich mit jedem von Euch gern unterhalten.» Sein Vorgänger wiederum, Bill Clinton, hatte damit allerdings kein Problem: Clinton benutzte im Weissen Haus nämlich überhaupt keinen Computer.