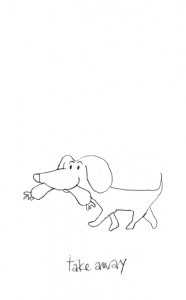Wo immer etwas schief läuft, da wird ein Sündenbock gesucht. Nur gut, dass wir es da nicht mehr so halten wie in der Bibel:
Und Aaron soll den Ziegenbock herbringen. Er soll seine beiden Hände auf seinen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetaten der Israeliten (…). Er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn (…) in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle Missetaten auf sich nehme und in die Wildnis trage. Und man lasse ihn in der Wüste.
Der zu einem grausamen Tod verurteilte Sündenbock stammt aus einer ausführlichen Opferanleitung des Alten Testaments. Dem dritten Buch Mose zufolge hat Gott das Ritual Moses älterem Bruder Aaron befohlen. Es bildet den Hintergrund des höchsten jüdischen Feiertags, des Jom Kippur. Der Jom Kippur, übersetzt «Tag der Sühne», wird von vielen Juden eingehalten. Gläubige fasten 25 Stunden lang. In Israel steht das öffentliche Leben still – die Strassen sind autofrei, Restaurants und Cafés sind ebenso geschlossen wie die Grenzübergänge und der Flughafen.
Die Vorstellung, einen Bock für die Menschen zu opfern, gibt es in vielen Kulturen. Auch in der Schweiz: Unterhalb von Göschenen liegt der 2000 Tonnen schwere Teufelsstein, der Sage nach vom Teufel aus Wut dorthin geschleudert. Für den erfolgreichen Bau der Teufelsbrücke hatte man ihm die Seele des ersten Wesens versprochen, das darüber ginge. Die Urner aber, bauernschlau, jagten als erstes einen Ziegenbock hinüber. Niemand kam zu Schaden – ausser einem armen Bock.