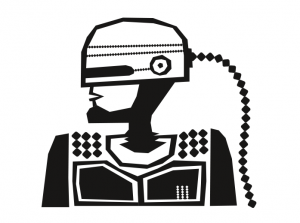Rhetorik ist Griechisch und heisst «Redekunst». Nicht alle, die Reden halten, sind Künstler – ob Tischreferat oder Ansprache: Reden ist Mundwerk und nur ganz selten wirklich Kunst.
Im alten Griechenland war die Rhetorik hoch angesehen. Sie zählte (zusammen mit Grammatik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) zu den sieben freien Künsten, der Bildung, nach der ein freier Mann strebte. Denn wem es gelang, vor Gericht oder auf dem Forum Menschen zu überzeugen, der hatte Macht.
So zu reden will geübt sein. Marcus Tullius Cicero war ein stotternder Aussenseiter im Establishment des alten Rom – und ein rhetorisches Jahrhunderttalent. Er studierte bei allen Meistern seiner Zeit. Ihren gekünstelten Stil (der in Rom führende Anwalt Hortensius wurde als «Tanzmeister» verspottet) fand Cicero lächerlich, und so schrieb er sich auf Rhodos beim griechischen Rhetor Molon ein. Einen ganzen Frühling und Sommer lang liess sich der junge Cicero drillen: Turnübungen, Atemübungen, Redeübungen – und kein einziges geschriebenes Wort, getreu Molons Devise:
Bei der Redekunst zählen nur drei Dinge: der Vortrag, der Vortrag und der Vortrag.
Und Cicero lernte gut: Zurück in Rom, brachte er den mächtigen Gaius Verres, den räuberischen Prätor von Sizilien, vor Gericht. Verres und sein Verteidiger, eben jener Tänzer Hortensius, hatten nicht den Hauch einer Chance: Von zwei verfassten Brandreden brauchte Ankläger Cicero nur die erste zu halten, da floh der korrupte Verres bei Nacht und Nebel nach Marseille und kehrte nie wieder zurück.
Von Anakoluth bis Zeugma: Rhetorische Figuren tragen bis heute antike Namen. Doch ob Anklage oder Poetry Slam – nur auf drei Dinge kommt es an: den Vortrag, den Vortrag und den Vortrag. (Das übrigens ist die womöglich älteste aller Figuren. Man nennt sie repetitio.)