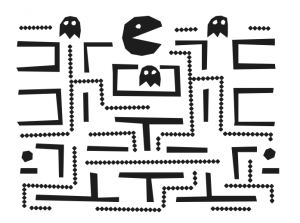Ruhm und Ehre – und sonst gar nichts: Dies wird Ihr Lohn sein, wenn Sie in nächtelanger Fronarbeit Computerprogramme schreiben und sich der Open-Source-Bewegung anschliessen. Das ist wenig, zugegeben, und erklärungsbedürftig ist es auch.
Open Source – dieser Begriff bezeichnet Software, die kostenlos ist. Jedermann darf sie im Internet herunterladen, nach Belieben nutzen und an beliebig viele andere weitergeben. Nicht nur das: Auch der Quelltext, also der für Programmierer lesbare Bauplan, ist für alle frei verfügbar und darf nach Herzenslust verändert und neu zusammengefügt werden. Die Open-Source-Bewegung glaubt, dass der Zugang zu Wissen immer häufiger die Benutzung von Computern voraussetzt. Die Hersteller von Programmen sollen daher, so lautet ihr elftes Gebot, von den Benutzern kein Geld verlangen.
Da hat uns also jenes amerikanische Unternehmen aus Redmond, das für Open-Source-Anhänger Teufel und Beelzebub in einem darstellt und hier für einmal nicht genannt werden soll, 30 Jahre lang weisgemacht, dass Computerprogramme eine ganz normale, teure Handelsware sind. Und nun erklären uns milchbärtige, chronisch übernächtigte und sich aus Pizzaschachteln ernährende Freaks allen Ernstes, dass – sinnbildlich – Privatverkehr ein Menschenrecht sei und sich daher jeder einen Wagen aussuchen und damit – mitsamt allen Plänen – einfach so und ohne zu zahlen nach Hause fahren darf.
Absurd? Keineswegs, sondern ein Erfolgsprogramm. Ein für alle privaten Zwecke bestens ausgerüsteter Computer lässt sich heute mit solchen Open-Source-Programmen betreiben. Das Betriebssystem Linux, das Office-Paket Open Office oder der Webbrowser Firefox – alles hört auf den Namen Open Source und ist ausgereift, einfach, leistungsfähig.
Milton Friedman, Übervater aller Ökonomen, formulierte das Grundgesetz der Marktwirtschaft so: «There ain’t no such thing as a free lunch». Friedman hatte nur fast recht: Kostenlose Mahlzeiten gibt’s tatsächlich nicht. Software dagegen schon.