In der Steinzeit müssen die Menschen davon geträumt haben: ein allzeit bereiter Auftragsjäger, der auf Kommando das Schnitzel erlegt und brät – in weniger als einer Viertelstunde. Der Gasthof des Mittelalters, eine Art «Come-on-in», kam dem Traum schon ziemlich nah, doch seine Vollendung heisst «Takeaway».
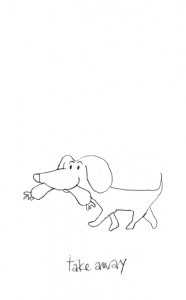
So unterschiedlich die Schnellküchen auch heissen mögen: Ihr Angebot ist einigermassen globalisiert. Pizza in allen Varianten, Kebab mit alles oder wenigstens mit viel Scharf, daneben fish and chips und natürlich Sandwiches und Wurst in allen Variationen.
Dass man bei soviel Einheitsbrei auch die lokale Küche pflegen kann, zeigt der oberfränkische Würstchenmann mit seinem rechteckigen, tragbaren Wurstkessel: 1881 erfand eine Metzgerei in der Stadt Hof den Wärschtlamo, und bis heute locken die Wärschtlamänner mit dem Ruf «haass senn sa, koid wern sa», heiss sind sie, kalt werden sie.
Takeaway muss dabei durchaus nichts Vergängliches sein: Ihrem Wärschtlamo haben die Hofer auf dem Sonnenplatz gar ein Denkmal gesetzt.