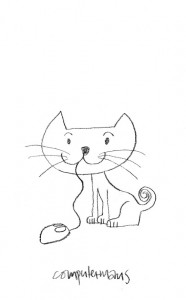Fast, lieber Reinhard Mey: Wirklich grenzenlos ist die Freiheit nicht über, sondern vielmehr in den Wolken. Vor allem dann, wenn es um die Freiheit geht, mit Daten und mit Programmen zu hantieren, wo immer man gerade ist. Cloud computing nennt sich das. Und es ist, kurz gesagt, das Arbeiten am Computer mit Daten aus dem Netz.
Kaum jemand, der das noch nie erlebt hat: Die Festplatte macht keinen Mucks mehr, und die letzte Datensicherung datiert vom Mittelalter. Briefe, Bilder, Programme – alles weg. Dagegen hilft Fluchen (für die Seelenhygiene), ein neuer PC (für die Arbeit), nur gegen den Datenverlust ist kein Kraut gewachsen. Es sei denn, die lägen in den Wolken des Web.
Cloud computing kann bedeuten, dass man für E-Mail nur noch web-basierte Dienste nutzt wie Hotmail, GMX oder Google Mail, die gleichzeitig Mailprogramm und den nötigen Speicherplatz zur Verfügung stellen – kostenlos. Oder auch das Anbieten von Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Datenablage durch Google, multi-user-fähig und ebenfalls gratis. Der heimische Computer treibt dabei nur noch den Web-Browser an.
Vorteil: Die Software up-to-date zu halten, ist Sache des Anbieters, man spart Geld und Speicherplatz, und mögliche Computerabstürze bleiben folgenlos. Nachteil: Daten und Dienste lassen sich nur nutzen, wenn man online ist, Anbieter können Bankrott gehen, und namentlich Google wertet E-Mails aus, um kontextabhängige Werbung zu verkaufen.
In der Wolke muss die Freiheit der Daten wohl grenzenlos sein. Nur ist sie auch da nicht ganz ohne Schattenseiten.