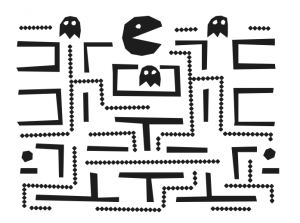Der sprichwörtliche Notnagel ist nichts, was man gerne wäre.
Du, Bursche? Was, du? Der Nothnagel zu sein, wo die Menschen sich rar machen?,
verhöhnt der Protagonist Major Ferdinand von Walter den dümmlichen, gestelzten Hofmarschall von Kalb in Friedrich Schillers Drama «Kabale und Liebe».
Der wirkliche Notnagel aber gehörte bis in die 1960er-Jahre zur festen Ausrüstung der Feuerwehr. Es ist ein rund 20 Zentimeter langer, kräftiger, spitz zulaufender Vierkantnagel, dessen oberes Ende eine seitliche Öse trägt, die aussieht wie ein nach unten offenes P. Den Notnagel trugen Feuerwehrleute in einer kleinen Ledertasche am Gürtel. Beim Bekämpfen eines Brandes konnte es nämlich vorkommen, dass ihnen die Flammen auf einmal den Weg abschnitten und ein Rückzug nicht mehr möglich war. Um sich in Sicherheit zu bringen, konnte der Feuerwehrmann seinen Notnagel mit dem Beil in einen Balken oder den Zimmerboden einschlagen und sich mit dem mitgeführten Seil durch ein Fenster hindurch ins Freie abseilen.
Eine Weiterentwicklung war der sogenannte Notring.
Dem Nothring ist der Vorzug vor dem Notnagel zu geben,
steht in den «Illustrierten Feuerlöschregeln für jedermann» von 1878,
da sein Stift mit starken Widerhaken versehen ist und dadurch ein Wiederherausgleiten desselben aus dem Holze nahezu unmöglich gemacht wird.
Der Notnagel oder der Notring waren daher alles andere als ein Notbehelf, sondern vielmehr ein einfacher, kostengünstiger und erstaunlich effektiver Lebensretter.