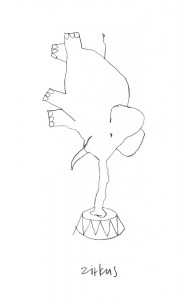So tönt es, wenn ein Pianist wie Herbie Hancock für einmal nicht Piano spielt, sondern Synthesizer, genauer: den legendären Yamaha DX7. Keine 250 Kilo schwer wie ein Klavier, sondern nur deren 10 und dazu bloss einen Meter breit und 10 Zentimeter dick, war der DX7 auf Anhieb ein Star in Jazz und Pop. Nicht wegen seiner Grösse, sondern – natürlich – wegen seiner noch nie gehörten Sounds.
Der Yamaha DX7 ist ein Synthesizer, ein Tasteninstrument, das seinen Klang auf elektronischem Weg erzeugt. 1967 entwickelte der amerikanische Musikprofessor John Chowning einen Algorithmus für die sogenannte Frequenzmodulationssynthese. Dabei werden die Schallwellen eines bestimmten Tons durch Überlagerung rechnerisch verändert, und es entstehen nie dagewesene Klänge.
1974 lizenzierte der japanische Konzern Yamaha das Prinzip, und das Keyboard, das 1983 auf den Markt kam, stellte alles Bisherige in den Schatten. Polyphon, mit frei programmierbaren Tönen, die sich gar auf externen Datenträgern speichern liessen: Die Songschreiber der Achtziger waren begeistert. «Chicago», Whitney Houston, der Soundtrack zum Film «Top Gun» – alle griffen sie zum Yamaha DX7.
Die Erfindung des Tüftlers Chowning lieferte den Sound für ein ganzes Jahrzehnt – und beeinflusst den Pop und den Jazz bis heute.