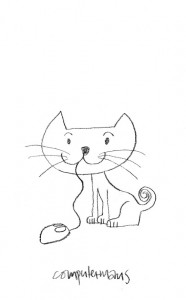Dies ist eine schöne künstliche Maschine, die sehr nützlich ist, weil man mit ihr in einer grossen Menge Bücher blättern kann, ohne sich von der Stelle zu bewegen.
So beschreibt der italienische Ingenieur Agostino Ramelli 1588 das von ihm erfundene Bücherrad. Diese Lesemaschine sieht ein bisschen aus wie ein Wasserrad für Bücher. Es besteht aus einem Holzgestell und zwei mannshohen Radscheiben. Dazwischen befinden sich acht Lesepulte, die von Zahnrädern so bewegt werden, dass die aufgeschlagenen Bücher ihre Neigung stets behalten und nicht zu Boden fallen. Auf diese Weise kann ein Leser durch einfaches Drehen zwischen verschiedenen Bänden und Textstellen hin und her springen – das Bücherrad gilt deshalb auch als eine Art Kindle des 16. Jahrhunderts.
Das Bücherrad wird im 700-Seiten-Wälzer mit dem Titel «Die verschiedenen und kunstvollen Maschinen des Capitano Agostino Ramelli» als einer von insgesamt 195 Apparaten beschrieben und abgebildet. Im Grunde war das Bücherrad unnötig kompliziert: Solche epizyklischen Getriebe waren bis dahin nur in astronomischen Uhren verbaut worden. Vermutlich auch deshalb hat Ramelli selbst nie ein solches Bücherrad gebaut, es ging ihm vor allem darum, sein mathematisches Genie unter Beweis zu stellen.
Ob es Bücherräder tatsächlich gegeben hat, ist nicht bekannt, doch aufwändige Nachbauten sind in einer ganzen Reihe europäischer Museen zu sehen.